Wie ich auf die Idee kam, ein Buch namens “Der Mauerspringer” zu schreiben[1]
Von Peter Schneider[2]
Im Herbst 1980 kehrte ich von einer längeren Reise durch Lateinamerika nach Berlin zurück und sah das bekannteste Bauwerk der Stadt aus dem Abstand – als etwas ganz und gar Unbekanntes, eigentlich Unbegreifliches, Monströses, das dringend einer neuenBeschreibung bedurfte. Der Held meines Romans sollte nicht eineFigur sein, sondern die Mauer selbst– und was sie mit den Menschen, die in ihrem Schatten lebten, eigentlich machte.
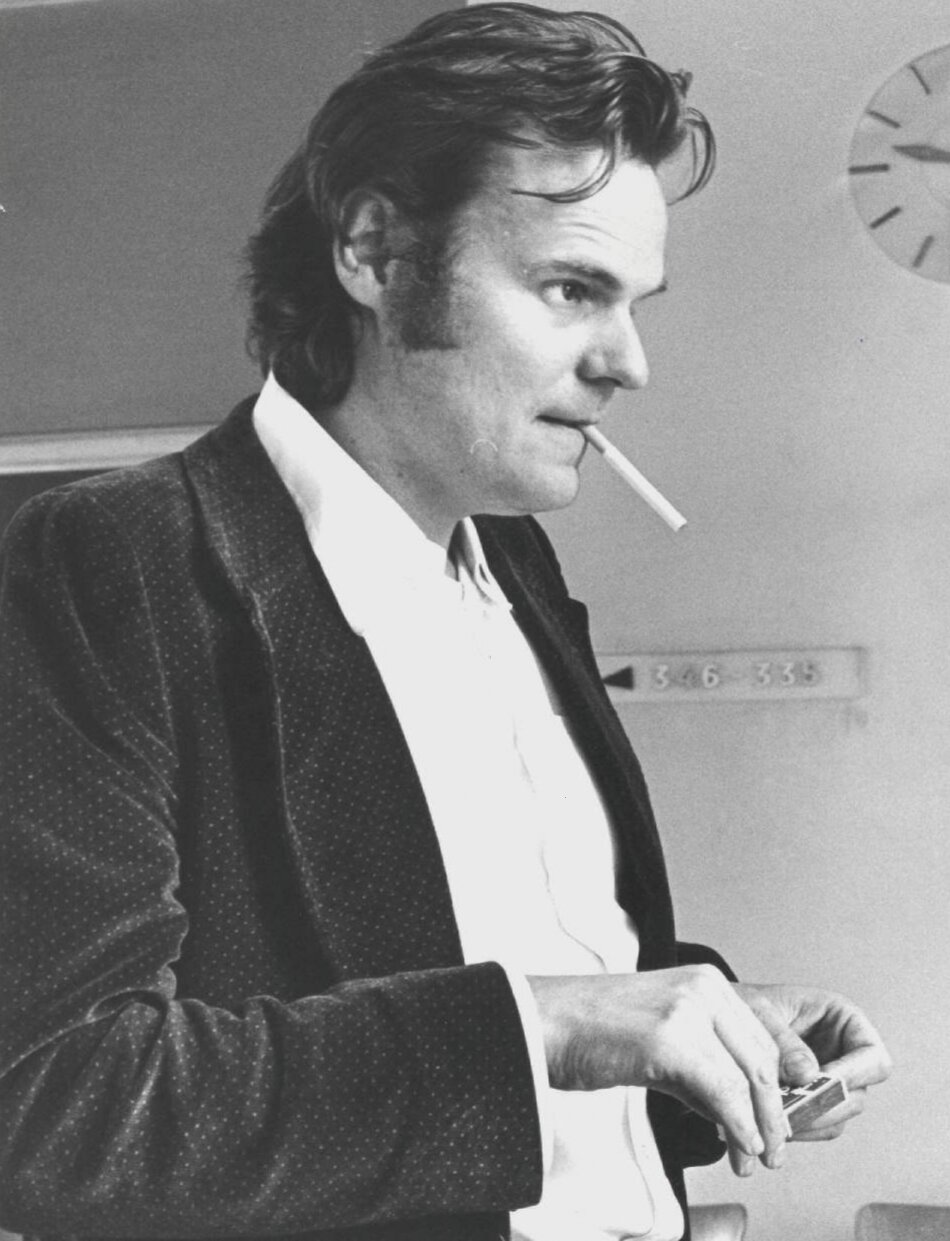
Ich ging einer Meldung über einen verwirrten jungen Mann nach, auf die ich im Berliner „Tagesspiegel“ gestoßen war. Es handelte sich um einen zwielichtigen Rebellen aus der DDR, der sich nach einem gescheiterten Fluchtversuch, kaum aus DDR-Haft entlassen, vorgenommen hatte, Ost- und Westdeutschland auf eigene Faust zu vereinigen, dabei in die Fänge des amerikanischen und des östlichen Geheimdienstes geriet, beide in seine Pläne einweihte in der Meinung, sie für sich in Dienst nehmen zu können, in Wahrheit von beiden Diensten ausgenutzt wurde und zum Schluss nicht mehr wusste, für welchen Dienst er eigentlich arbeitete.
Als ich dieseGeschichte, um sie auszuprobieren, dem einen oder anderen Bekanntenmal diesseits, mal jenseits der Mauer erzählte, machte ich eine überraschende Erfahrung: Die Geschichte löste sofort andere, ähnliche Geschichten aus. Immer wieder hörte ich einen Satz, der später zu einem Scharnier in meinem Buch geworden ist. „Da kenne ich eine viel bessere Geschichte!“
Durch meine Gesprächspartner stieß ich darauf, dass es auf beiden Seiten der Mauer Leute gab, die einem gefährlichen Hochleistungs-Sport nachgingen: Sie überquerten die Mauer nicht nur ein oder zweimal, sondern gelegentlich sogar in beide Richtungen. Indem sie Visa-und Ausreiseanträge ignorierten, setzten sie die Grenze gleichsam außer Kraft. Wer waren am Ende eigentlich die Verrückten, überlegte ich, die Mauerspringer oder die große Mehrzahl der Deutschen, die sich mit der Mauer längst abgefunden hatten und sie als die gerechte Strafe für den von den Deutschen begonnenen und verlorenen zweiten Weltkrieg betrachteten?
Wer die deutsche Teilung und die Mauer in Frage stellt, hieß ein Glaubenssatz der westdeutschen Linken, stellt die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs in Frage. Dieser Satz gab jedoch keine Antwort auf die Frage gab, warum zum Beispiel die Polen, die doch auf der Seite der Sieger gekämpft hatten und auf die falsche Seite der Mauer geraten waren, dieselbe Strafe erleiden sollten wie die Deutschen. Und warum waren die Westdeutschen, von denen die meisten unter der Mauer gar nicht mehr litten, so bereit, diese Strafe auf sich zu nehmen, während die Ostdeutschen sich keineswegs damit abfinden wollten?
Der Regisseur Reinhard Hauff fand Gefallen an der Geschichte und schlug mir vor, ein Drehbuch zu schreiben. Als Grundlage benutzte ich die oben skizzierte Geschichte aus dem Tagesspiegel, aus der dann der Film „Der Mann auf der Mauer“ geworden ist. Bei einem Drehbuch, so schien mir, musste ich mich auf e i n e Geschichte konzentrieren, ich konnte nicht zwischen sechs oder sieben Varianten hin und herspringen. Aber warum sollte ich auf all die anderen Geschichten, die vielleicht viel besser waren als die von mir gewählte, verzichten? Und was wurde aus meinem Plan, nicht eine Figur, sondern die Mauer zum Protagonisten zu machen? So begann ich schon während des Drehs, an einer Prosa-Version zu arbeiten: Ein Erzähler will herausfinden, was die Mauer für ihn und die Anwohner auf beiden Seiten der Mauer bedeutet, und wird dabei selber zu einer Art Mauerspringer.
Es dauerte eine Weile, bis ich soweit war, den Prozess meiner Recherchen in eine literarische Form zu übersetzen: in eine Rahmen-bzw. Kettengeschichte, die eine Serie von verschiedenen gleichberechtigten Helden nebeneinanderstellt.
ImAuslandistmein Buch “Der Mauerspringer” zu meinem größten Erfolg geworden. Es wurde in 25 Sprachen übersetzt und ist mit einem Vorwort des britischen Schirftstellers Ian McEwan in die Reihe “Penguin Modern Classics” aufgenommen worden. Die Reaktion der deutschen Rezensenten war eher gebremst, Ähnliches gilt für den Verkaufserfolg des Titels. Ich führe dieses Ergebnis auf die Zwitterform des Buchs zurück: Erzählungen wechseln mit essayistischen Einschüben und Reflektionen ab, der Leser wird aus den unterschiedlichen Emotionen, die die Geschichten erzeugen, immer wieder herausgerissen. Anfangs habe ich mich bei meinem damaligen Verlag Luchterhand gegen die Gattungsbezeichnung “Erzählung” gewehrt, um beim Leser erst gar nicht die Erwartung auf eine traditionell durcherzählte Geschichte aufkommenzulassen. Klaus Röhler, mein damaliger Lektor, überzeugte mich, dass es im Buchhandel keinen Büchertisch für Zwitter gibt – ein Buch gehörtent weder in die Gruppe Roman oder in die Abteilung Sachbuch. Also blieb es bei der Bezeichnung “Erzählung”.
Manchmal können Kommentare und Interpretationen eines Buches unvorhergesehene Folgen haben. Einer englischen Germanistin, die mir ihre Doktorarbeit über mein Buch schickte, war aufgefallen, dass ich ein Erzählmodell benutzte, das E.T.A.Hoffmanns „Serapionsbrüdern“ nachgebildet sei. Ich war verblüfft. Denn ich erinnerte ich mich daran, dass der einzige Autor, dessen Gesamtwerk ich im Alter 12 bis 15 Jahren beinahe durchgelesen hatte, E.T. A. Hoffmann war. An Hoffmann begeisterte mich der Sinn für das Abseitige und Monströse. Seine Geschichten gestatteten mir Ausflüge aus meinemFreiburger Alltag in eine andere Welt, die von Menschenautomaten, sprechenden Katern, kunstverliebten Mördern und Doppelgängern bevölkert war.
Also nahm ich mir sein seit Jahrzehnten nicht mehr aufgeschlagenes Werk noch einmal vor. Tatsächlich benutzt Hoffmann ein Erzählmodell, das in der Literatur eine lange Tradition hat. Ein Erzähler beginnt im Kreis von Freunden eine Geschichte zu erzählen, die einen Zuhörer dazu inspiriert, seinerseits eine Geschichte über ein verwandtes Motiv zu erzählen, was dann wiederum einen Dritten inspiriert, mit einer weiteren Geschichte aufzuwarten. Vielleicht das berühmteste Beispiel dieses Erzählprinzips ist Giovanni Boccacios „Decamerone“; Johann Wolfgang von Goethe hat es in seinen „Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderter“ benutzt, und E.T.A. Hoffmann in zahlreichen Varianten. Bekanntlich haben sich Hoffmann und seine Freunde in einer Berliner Kneipe namens Lutter/ Wegner getroffen, in der sie sich gegenseitig Geschichten erzählten oder vorlasen und dabei reichlich tranken. Hoffmann, immerhin Richter am preußischen Kammergericht in Berlin soll in dieser Kneipe Abend für Abend unbezahlte Rechnungen für drei bis vier Flaschen Wein hinterlassen haben. Die E.T.A.Hoffmann-Gesellschaft, die ich dazu befragte, klärte mich darüber auf, dass der Wein zu Hoffmanns Zeiten nicht mehr als 7 Prozent Alkohol enthaltenhabe. Nur Jaques Offenbach mit seiner Oper „Hoffmanns Erzählungen“ sei es zu verdanken, dass die Legende vom Trunkenbold Hoffmann fortlebe.
Nachdem ich meiner englischen Spurensucherin per Postkarte meinen Dank und ein Kompliment geschickt hatte, beschloss ich, bei meinem nächsten Roman-Projekt den vielleicht unbewusst wirkenden Einfluss E.T. Hoffmanns explizit in Szene zu setzen. Der Roman „Paarungen“ nimmt das Thema von „Mauerspringer“ auf einer anderen Ebene wieder auf. Drei Berliner Helden nehmen den Kampf gegen einen in Berlin grassierenden „Trennungsvirus“ auf, indem sie sich gegenseitig über den Stand ihrer ständig vom Scheitern bedrohten Ehen unterrichten. Der Roman lässt sich durchaus als eine Fortsetzung des „Mauerspringer“ lesen und benutzt auf geradezu aufdringliche Weise das Modell, das E.T.A.Hoffmann mit seinen „Serapionsbrüdern“ hinterlassen hat. Selbst die Vornamen der Helden Eduard, Theo und André erweisen dem Inspirator E. T. A. Hoffmann Referenz. Ganz zu schweigen von der Kneipe „Tent“, deren Name auf einen bei Hoffmann und seinen Freunden beliebten und wegen Bordellnähe anrüchigen Treffpunkt namens „Unter den Zelten“ anspielt. Leider hat keiner meiner Rezensenten diese Anspielungen bemerkt. Aber ich höre, man könne den Roman „Paarungen“ verstehen und sogar genießen, auch wenn man nie eine Zeile der „Serapionsbrüder“ gelesen hat.
Ohnehin bin ich durch das Schreiben zu dem Schluss gekommen, dass die Form eines Romans in der Auseinandersetzung mit seinem Stoff entsteht; sie kann ihm nicht durch ein externes Programm –etwa durch die Vorgabe, man müsse das Erzählen miterzählen – aufgezwungen werden. Im Fall des „Mauerspringer“ erschien mir die Form des essayistischen Erzählens angebracht. Einen Satz wie: es werde länger dauern, die Mauer im Kopf zu überwinden als das Ding aus Beton, hätte ich in einem traditionell erzählten Roman gar nicht unterbringen können, bzw. er hätte darin kein Gewicht gehabt.
Ein überraschendes Kompliment für den „Mauerspringer“ ist mir im Kopf geblieben. Es stammt vom Rezensenten der „Welt“, dem seine Zustimmung bei seinen sonstigen Vorbehalten gegen den Autor vielleicht etwas unheimlich war. Das Buch, schrieb er, sei entschieden klüger als sein Autor. Ja, so etwas kommt vor.
[1] Überarbeitete Ausschnitte aus einem Vortrag in Göttingen (2008)
[2] Schriftsteller Berlin