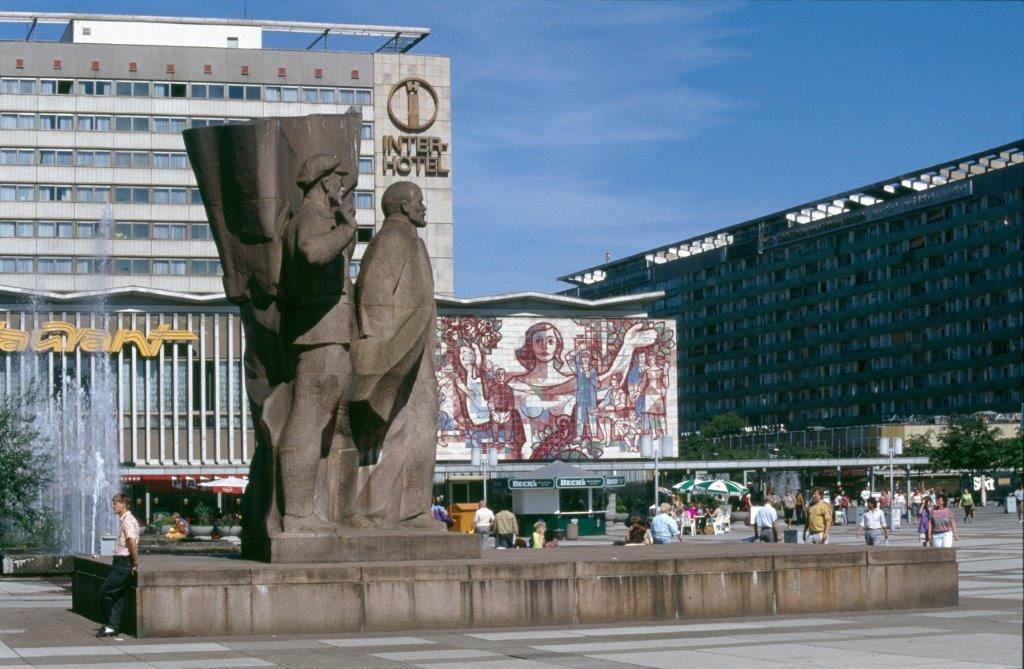Die politische Steuerung der Treuhandanstalt
von Andreas Malycha
Die am 1. März 1990 durch einen Beschluss der DDR-Regierung gegründete Treuhandanstalt war zwar eine formell unabhängige Behörde, sie agierte jedoch nicht losgelöst von staatlichen und politischen Instanzen. Die Tätigkeit der Treuhandanstalt vollzog sich nicht nur unter dem Einfluss der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, sondern auch im Umfeld von kontroversen, nicht selten von Politikern und Wirtschaftswissenschaftlern in der Öffentlichkeit geführten Debatten über das Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Insofern wurde der Handlungsrahmen sowie die inhaltliche Ausrichtung der Treuhandanstalt auch durch die öffentlichen Debatten und Interaktionen zwischen Politik, Wissenschaft und medialer Öffentlichkeit stark beeinflusst.[1]
Die Regierung unter Lothar de Maizière (CDU) setzte im Frühjahr 1990 neue ordnungspolitische Prioritäten und schwenkte auf einen Kurs des Übergangs zur sozialen Marktwirtschaft. Somit bekam auch die Treuhandanstalt einen neuen Auftrag: Nicht mehr die Bewahrung des ehemals staatlichen Eigentums, sondern dessen Privatisierung hatte nunmehr Priorität.
Ende April 1990 überführte Ministerpräsident de Maizière die Anstalt in seinen Geschäftsbereich. Sie wurde dem Minister im Amt des Ministerpräsidenten, Klaus Reichenbach (CDU), unterstellt. Reichenbach stützte sich in seiner fachlichen Verantwortung für die Treuhand vorwiegend auf die Zusammenarbeit mit dem DDR-Wirtschaftsministerium, das durch die Übernahme von Personal aus den aufgelösten Industrieministerien über die notwendigen personellen Ressourcen für die Umsetzung wirtschaftlicher Reformen verfügte. Die praktische Zuständigkeit für die Treuhand lag dann entgegen Bonner Empfehlungen ausschließlich beim Ministerium für Wirtschaft.
Im Juli/August 1990 gab es mehrere Gespräche zwischen den Bonner Ministerien für Finanzen sowie Wirtschaft und Treuhandpräsident Detlev K. Rohwedder, der am 29. August 1990 an die Spitze der Treuhand berufen wurde. In mehreren Gesprächen ging es um die Frage, zu welcher Fachaufsicht des Bundes die Treuhandanstalt als künftige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts zugeordnet werden sollte. Letztlich einigte man sich zwischen Wirtschafts- und Finanzministerium des Bundes darüber, dass der Bundesminister der Finanzen die Fachaufsicht im „Einvernehmen“ mit dem Bundesminister für Wirtschaft wahrnehmen sollte. Mit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages zum 3. Oktober 1990 ging die Fachaufsicht auch in praktischer Hinsicht auf das Bundesministerium der Finanzen (BMF) über. Seitdem gehörten Horst Köhler, Staatssekretär im BMF, sowie Dieter von Würzen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), als Mitglieder dem Verwaltungsrat der Treuhandanstalt an.
Staatssekretär Köhler versuchte zunächst, über das BMF möglichst großen Einfluss auf die Personalpolitik der Berliner Treuhandzentrale auszuüben, insbesondere bei der Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen von Treuhandunternehmen. Rohwedder machte jedoch seinen weiteren Verbleib als Präsident der Anstalt von seiner Forderung abhängig, den Handlungs- und Entscheidungsspielraum des Treuhandvorstandes nicht durch ständige Weisungen und einzelfallbezogene Eingriffe des Ministeriums einengen zu lassen. Demensprechend wurde die Fachaufsicht durch das BMF zunächst relativ großzügig umgesetzt und auf die Auskunfts- und Informationspflicht beschränkt. Strittige Fragen sollten zunächst im Vorfeld von Verwaltungsratssitzungen geklärt werden. Mit diesem Verständnis erhielt die Treuhand jenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum, den Rohwedder für die Wahrung der unternehmerischen Unabhängigkeit und Eigenverantwortung gefordert hatte.
Direkte Arbeitsbeziehungen gab es zum Bundeskanzleramt, insbesondere zum Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik, Johannes Ludewig. Ludewig, den der Bundeskanzler zugleich zum Sonderbeauftragten für den „Aufbau Ost“ ernannt hatte, nahm regelmäßig an den Sitzungen des Präsidialausschusses des Verwaltungsrates der Treuhandteil und war dadurch über die im Verwaltungsrat zu behandelnden Privatisierungsvorgänge und Sachverhalte bestens informiert. Als informelles Gremium erlangte zudem die sogenannte Ludewig-Runde besondere Bedeutung, die seit Mitte Mai 1991 in regelmäßigen Abständen als Koordinierungsinstrument des Bundeskanzleramtes unter Vorsitz von Ludewig zusammentrat. An den Treffen nahmen in der Regel Vertreter des Bundeskanzleramtes, die Chefs der Staatskanzleien der Neuen Bundesländer sowie der Generalbevollmächtige der Treuhandanstalt, Wolfgang Müller-Stoeven teil. Ziel der Treffen war es zunächst, die Realisierung der Beschlüsse der Bundesregierung zum „Aufbau Ost“ zu koordinieren sowie Informationen über allgemeine Probleme des ökonomischen Umbaus der ostdeutschen Wirtschaft auszutauschen. Darüber hinaus gab es informelle Gesprächskreise unter der Leitung von Rudolf Seiters, dem Chef des Bundeskanzleramtes. In unregelmäßigen Abständen fanden darüber hinaus sogenannte Kanzlergespräche statt. Diese waren jedoch keine Gespräche ausschließlich zwischen der Treuhandanstalt und der Bundesregierung, sondern eher gesamtwirtschaftliche Gespräche zu einem besonderen Themenkreis, so beispielsweise über die wirtschaftliche Entwicklung in den Neuen Bundesländern.
Da die Treuhand trotz ihres Status als bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts weder als Unternehmen noch faktisch als staatliche Behörde fungierte, sorgte die Frage nach ihrer Handlungsautonomie gegenüber der Bundesregierung für potenzielle Konflikte. Beim Abschluss der Privatisierungsverträge beanspruchten sowohl die zuständigen Vorstandsmitglieder als auch die Branchendirektoren der Treuhand einen großzügigen Handlungsspielraum, der in vielen Fällen den internen Richtlinien widersprach. Denn im Treuhandvorstand herrschte das Selbstverständnis von einem marktwirtschaftlich operierenden Unternehmen vor, das sich durch ein Bundesministerium nicht in die Privatisierungsverhandlungen hineinreden lassen wollte. Aus diesem Selbstverständnis heraus erklärt sich der Umstand, dass selbst jene Privatisierungsverträge, die dem BMF entsprechend der beschlossenen Richtlinien zur Bestätigung vorgelegt werden mussten, ohne Kenntnis der Bonner Fachaufsicht unterzeichnet wurden.
Während der Amtszeit von Birgit Breuel, die von Verwaltungsrat am 13. April 1991 nach der Ermordung von Detlev Rohwedder zur Präsidentin der Treuhandanstalt gewählt wurde, brachen offene Konflikte zwischen Treuhandvorstand und Bonner Behörden auf. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit beklagte sich die Präsidentin in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Theo Waigelvom Mai 1991 über eine vermeintliche Überbeanspruchung der Treuhand durch vermehrte Anfragen und Forderungen von verschiedenen Beamten der beiden Bundesministerien. Breuel wies in Gesprächen mit Vertretern des Bundes wiederholt darauf hin, dass die Treuhand durch ihre Aufgabenerfüllung an der Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft eine Sonderstellung einnehmen würde. Während eines Gesprächs mit Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann im Juli 1992 in der Treuhandzentrale bat sie darum, im politischen Raum deutlich mehr Verständnis für die Tatsache zu erhalten, dass die Treuhand eben kein normales Unternehmen sowie auch keine Bundesbehörde sei. Die Vielzahl der Themen von der Privatisierung über die Reprivatisierung, den Immobilienverkauf, das Parteivermögen, die Kommunalisierung und die Geschwindigkeit der Aufgabenerledigung gestatte es nicht, übliche Rechnungshofmaßstäbe anzulegen.[2]
Die Kontrolle durch den Bundesrechnungshof empfand der Treuhandvorstand zunehmend als eine Behinderung seiner unternehmerischen Tätigkeit. Die Organaufsicht über die Tätigkeit der Treuhand berührte im Rahmen der Bundeshaushaltsordnung auch die Kontrolle durch den Bundesrechnungshof als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle. Dessen Kontrollrechte umfassten die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Treuhand und damit ihre finanzwirtschaftliche Tätigkeit. Der Rechnungshof beschränkte seine Kontrolltätigkeit jedoch keineswegs nur auf die Wirtschaftsführung der Treuhand, sondern dehnte sie auf wesentliche Arbeitsbereiche im Rahmen von sogenannten Schwerpunktprüfungen aus. In der Regel folgte der Treuhandvorstand den Empfehlungen des Rechnungshofes nur in sehr eingeschränktem Maß. Rückblickend schätzte Breuel dessen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Treuhand als eher gering ein. Von größerer Bedeutung war dagegen das Bild, das auf der Basis von Berichten des Rechnungshofes in der Öffentlichkeit bzw. im politischen Raum präsentiert wurde.
Insbesondere tat sich die Präsidentin mit dem Umstand schwer, dass die ministerielle Fach- und Rechtsaufsicht auch mit einer gewissen parlamentarischen Kontrolle verbunden war, die sich nicht nur auf die Haushaltsbewilligung bezog. Im Oktober 1990 hatte sich in Bonn der Unterausschuss Treuhandanstalt des Haushaltsausschusses als parlamentarisches Kontrollgremium des Deutschen Bundestages konstituiert. Er beschäftigte sich nicht nur mit der Bewilligung von Haushaltsmitteln für die Treuhand, sondern befasste sich auch mit Schwerpunkten von deren Geschäfts- und Privatisierungspolitik. Nicht selten musste Bundesfinanzminister Waigel vor diesem Gremium umstrittene bzw. fragwürdige Privatisierungen rechtfertigen. Der Ausschuss entwickelte sich mit der Zeit jedoch zu einem regelrechten politischen Kampffeld zwischen Regierung und Opposition. Insbesondere kam es in dem Anfang 1993 gebildeten Ausschuss Treuhandanstalt des Bundestages zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Abgeordneten der Regierungsparteien CDU, CSU sowie FDP und den Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie PDS. Mit der Zunahme kritischer Medienberichte standen nicht nur die Ausschussmitglieder der Oppositionsparteien, sondern auch die Abgeordneten aus den Reihen der Regierungskoalition, insbesondere ostdeutsche CDU-Abgeordnete, der Treuhandpolitik auffallend kritisch gegenüber. Angesichts der deutlichen zutage tretenden Probleme beim Strukturwandel der ostdeutschen Wirtschaft und der sozialen Folgen des Übergangs zu einer Marktwirtschaft forderten nun auch ostdeutsche Bundestagsabgeordnete der CDU immer drängender gesicherte Zukunftsperspektiven für die Menschen im Osten und gaben den Unmut über das Ausbleiben des versprochenen wirtschaftlichen Aufschwungs direkt an die Treuhand weiter.
Nachdem die Treuhandspitze in den Jahren 1990 und 1991 weitgehend unabhängig von den wirtschafts- und finanzpolitischen Erwägungen der Bonner Ministerien, insbesondere beim Aufbau ihrer Organisationsstruktur und der Privatisierungspraxis, handeln konnte, verengte sich seit Anfang 1992 ihr Handlungs- und Entscheidungsspielraum, insbesondere im Hinblick auf die Fachaufsicht des BMF. Bonner Ministerialbeamte griffen nun in die Gestaltung der inneren Organisation der Treuhandzentrale ein. So wurden vor dem Hintergrund staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen einzelne Vorstandsmitglieder und Branchendirektoren und auf nachhaltigen Druck der Bonner Fachaufsicht die Innenrevision und das Vertragsmanagement auf- und ausgebaut. Angesichts der wachsenden öffentlichen Kritik an der Privatisierungspolitik des Treuhandvorstandes und der zunehmend kritischer werdenden Anfragen parlamentarischer Kontrollgremien verstärkte sich die politische Einflussnahme aus Bonn. Die Fachaufsicht beschränkte sich jetzt nicht mehr nur auf die Einhaltung haushaltsrechtlicher Bestimmungen, sondern dehnte sich jetzt auf Privatisierungsverhandlungen unterhalb der Zustimmungsebene im Verwaltungsrat aus. Daraus ergaben sich rasch weitere Konfliktfelder zwischen dem Treuhandvorstand und den Bundesministerien.
Im Oktober 1993 schrieb die Präsidentin an Finanzminister Waigel von einer deutlich veränderten Qualität in der Zusammenarbeit zwischen dem Treuhandvorstand und dem Bonner Ministerium, die sie und ihre Vorstandskollegen mit Befremden registriert hätten. Mit großer Sorge betrachte der Vorstand vor allem, dass sich Form und Stil des Umgangs des Ministeriums mit der Treuhandanstalt in den letzten Wochen in gravierender Weise geändert habe. Dies werde deutlich in der wachsenden Zahl punktueller aufsichtsrechtlicher Maßnahmen und Anfragen und in dem größeren zeitlichen Rahmen, den Entscheidungsprozesse in Bonn beanspruchten. Gleichzeitig würden Treuhandmitarbeiter immer öfter darüber berichten, dass auf der Arbeitsebene vonseiten des BMF die ursprüngliche Bereitschaft zu einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit nachlasse und vermehrt misstrauische und maßregelnde Töne zu vernehmen seien. Zugleich sah Breuel die Gefahr, dass die Treuhandanstalt mehr und mehr aus ihrer Rolle einer weitgehend selbständig entscheidenden, in ihren Organen an einer Aktiengesellschaft orientierten Anstalt in die Abhängigkeit einer nachgeordneten Bundesbehörde gedrängt werden soll. Dies hätte ihrer Meinung nach weitreichende Konsequenzen und wäre ein Zustand, in dem der Privatisierungsauftrag nicht mehr auftragsgemäß durchgeführt werden könne.[3]
Für das spannungsreiche Verhältnis zwischen der Treuhandzentrale in Berlin und den zuständigen Bundesministerien in Bonn bleibt Folgendes festzuhalten: Bei der Privatisierung der ostdeutschen Industriebetriebe spielte die Treuhandanstalt in der öffentlichen Wahrnehmung die Hauptrolle, während die Bundesregierung stets im Hintergrund blieb. Der Treuhand wurde eine Rolle übertragen, die die Bundesregierung nicht übernehmen wollte. Sie war offiziell der Träger aller unpopulären Entscheidungen und wurde für alle Fehler und Pannen verantwortlich gemacht. Ganz ähnlich sahen dies einige Direktoren in der Treuhandzentrale selbst. Diese benutzten intern den Ausdruck „Sündenbock“, um deutlich zu machen, welche politische Funktion die THA für die Bundesregierung hatte.
Tatsächlich vollzog sich die Privatisierungspraxis der Treuhand maßgeblich unter dem Einfluss der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung. Insofern wurde der Handlungsspielraum der Treuhand auch durch die politischen Einflussnahmen der Bonner Ministerien stark beeinflusst. Während der laufenden Privatisierungsverhandlungen beschränkten sich Treuhandvorstand und BMF in der Regel auf eine mündliche Kommunikation, häufig in Form von Vier-Augen-Gesprächen oder Telefonaten. Der offizielle Weg über Aktenvermerke oder Schriftverkehr sollte tunlichst vermieden werden. In wirtschaftspolitisch und politisch bedeutsamen Privatisierungsfällen engagierte sich Bundeskanzler Helmut Kohl mitunter auf höchster politischer Ebene und schaltete sich in die Verhandlungen ein. Das Bundeskanzleramt unternahm jedoch alles, um Kohl aus der öffentlichen Wahrnehmung dieser Vorgänge herauszuhalten. In der Öffentlichkeit wurde der Eindruck vermittelt, die Treuhandspitze habe allein die Privatisierungsentscheidungen zu verantworten, insbesondere offensichtliche Fehlentscheidungen. In der Regel verhielten sich der Bundeskanzler, aber auch die zuständigen Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft in den öffentlichen Debattenüber vermeintliche Fehlentscheidungen der Treuhand zurückhaltend und reagierten nur bei besonders medienwirksamen Skandalen. Die Reaktionen des Bundeskanzlers beschränkten sich hauptsächlich auf allgemein gehaltene Solidaritätsadressen.
In der öffentlichen Wahrnehmung hatte sich die Treuhand in den Jahren von 1990 bis 1994 vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben gewandelt. In der Praxis des Wirtschaftsumbaus hatte die Bundesregierung der Treuhand zwar weitgehende Gestaltungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume eingeräumt. Zugleich musste sie damit aber auch die alleinige Verantwortung für die Misserfolge der wirtschaftlichen Transformation tragen. Sie blieb angesichts andauernder Massenarbeitslosigkeit ein politischer Blitzableiter für enttäuschte Hoffnungen und Erwartungen etlicher Menschen im Osten Deutschlands. Dabei geriet die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die zu weiten Teilen doch wirtschaftspolitische Strukturpolitik war, aus dem Sichtfeld. Das umso mehr, als die Bundesregierung mit ihrem Programm der „industriellen Kerne“, dem „Solidarpakt“ und anderen wirtschaftspolitischen Förderprogrammen wesentliche strukturpolitische Weichen in Ostdeutschland stellte. Darüber hinaus bleiben bei der Fokussierung auf die Treuhand die Rolle der ostdeutschen Landesregierungen und deren wirtschaftspolitische Entscheidungen weitgehend unterbelichtet.
[1] Vgl. Marcus Böick: Die Treuhand. Idee – Praxis – Erfahrung, Göttingen 2018; Andreas Malycha: Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben. Die Treuhandanstalt zwischen wirtschaftlichen Erwartungen und politischen Zwängen 1989-1994, Berlin 2022.
[2] Vgl. Malycha, Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben, S. 632.
[3] Vgl. Malycha: Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben, S. 639.